Klinker
Gebrannter Stein mit bleibender Präsenz
Klinker sind mehr als Fassadenmaterial. Sie sind gebrannter Ton, verdichtet durch hohe Temperaturen, widerstandsfähig gegen Witterung, mechanisch belastbar und kulturell tief verwurzelt. Ob als Wand, Boden oder Belag – Klinker prägen das Bild ganzer Städte und Landschaften.
Doch ihre Selbstverständlichkeit im Bau wirft Fragen auf: über Energieaufwand, Lebensdauer, Wiederverwendung. Klinker laden dazu ein, die Balance zwischen Tradition und Zukunft neu zu betrachten.


Ein Stoff, viele Facetten
Klinker entstehen aus Ton, der bei Temperaturen von über 1.100 °C gebrannt wird. Durch die hohe Verdichtung sind sie frostbeständig, wasserabweisend und langlebig. In Varianten reichen sie von Verblendern über Pflasterklinker bis zu Bodenplatten.
Historisch prägten sie seit dem 19. Jahrhundert die Architektur Norddeutschlands und der Niederlande. In expressionistischen Fassaden, in Industriebauten, in Wohnquartieren des 20. Jahrhunderts fanden Klinker ihren Platz – als robuste, wartungsarme und gleichzeitig gestalterisch vielfältige Oberfläche.
Die Farbpalette reicht von warmen Rottönen über dunkle Braunnuancen bis zu fast schwarzen Oberflächen. Jede Charge trägt die Spuren des Tons, der Herkunftsregion und des Brandverfahrens.
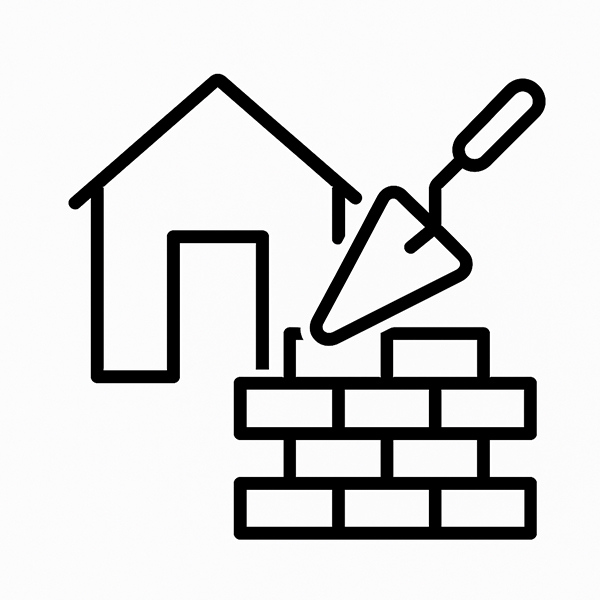
Sinnvolle Verwendung
Klinker eignen sich für Fassadenbekleidungen, die wetterbeständig und wartungsarm sind. Als Bodenbeläge überzeugen sie durch Härte und Strapazierfähigkeit, im Außenbereich durch Frostsicherheit. In Innenräumen schaffen sie robuste, atmosphärisch dichte Oberflächen.
Material im Zusammenspiel
Klinker entfalten ihre Wirkung besonders in Kombination mit anderen Materialien: Sie kontrastieren mit Glas und Metall, ergänzen Beton und harmonieren mit Holz. In zweischaligem Mauerwerk bilden sie zusammen mit Dämmstoffen und tragendem Hintermauerwerk ein funktionales System. Als Bodenbelag arbeiten sie mit Mörtel, Fugenmassen und Untergründen – ihre Qualität entsteht erst im Zusammenwirken.

Zwischen Herkunft und Zukunft
Die Herkunft des Tons prägt die Qualität und Farbe der Klinker. Der Abbau verändert Landschaften, während der Transport Einfluss auf die Bilanz nimmt. Der Brennprozess ist energieintensiv – traditionell durch fossile Brennstoffe betrieben, zunehmend durch erneuerbare Energien ergänzt.
Die Zukunftsperspektiven liegen in innovativen Brenntechnologien, in elektrischen Hochtemperaturöfen und in der Nutzung von grünem Wasserstoff. Auch Recycling und Wiederverwendung gewinnen an Bedeutung: Rückgebaute Klinker lassen sich reinigen und erneut einsetzen, wenn auch mit logistischem Aufwand.


Material im Lebenszyklus
Umweltproduktdeklarationen (EPDs) für Klinkerprodukte verdeutlichen:
• Herstellung: Tonabbau und Brennprozess bestimmen den größten Teil der Umweltwirkungen. CO₂-Emissionen entstehen durch den Energieeinsatz im Brennofen.
• Nutzung: Klinker sind nahezu wartungsfrei, langlebig und unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit oder Frost. Ihre lange Nutzungsphase von 50 bis über 100 Jahren verbessert die Gesamtbilanz erheblich.
• End-of-Life: Rückgewonnene Klinker können wiederverwendet oder als Gesteinskörnung recycelt werden. Herausforderungen liegen in der sortenreinen Trennung beim Rückbau.
Die Lebenszyklusperspektive macht deutlich: Klinker sind vor allem dann nachhaltig, wenn ihre Robustheit konsequent genutzt wird – also in Bauwerken, die für Generationen gedacht sind.

Keine einfache Wahrheit
Klinker gelten als robust und dauerhaft – doch ihre Herstellung belastet durch hohen Energieeinsatz und CO₂-Emissionen. Ihre lange Lebensdauer verbessert die Bilanz, wenn sie über Generationen genutzt werden. Gleichzeitig erschwert die feste Verbindung im Mauerwerk den Rückbau und die sortenreine Wiederverwendung.
So zeigt sich ein Spannungsfeld: Klinker sind weder ökologisch makellos noch verzichtbar. Sie stehen für Dauer, aber auch für Energieverbrauch. Ihre Nachhaltigkeit hängt weniger von der Herstellung ab als von der Frage, wie lange sie genutzt werden.

Material als Haltung
Klinker sind mehr als gebrannte Steine. Sie verkörpern eine Haltung, die Beständigkeit über Kurzlebigkeit stellt. Ein Haus aus Klinkern erzählt von Dauer, von Verankerung in einer Baukultur, die über Jahrzehnte Bestand hat.
Wer Klinker wählt, entscheidet sich für ein Material, das Ruhe und Beständigkeit ausstrahlt – und damit Verantwortung gegenüber kommenden Generationen übernimmt. Klinker erinnern daran, dass Nachhaltigkeit nicht nur in neuen Technologien liegt, sondern auch im bewussten Fortführen von Traditionen, die durch Zeit, Nutzung und Geduld Bestand gewinnen.

Die vorliegende Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach EN 15804+A2 wurde vom Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V. für Vormauerziegel und Klinker erstellt. Sie basiert auf Produktionsdaten aus dem Jahr 2021, die von elf Mitgliedsunternehmen an elf Standorten erfasst wurden und rund 90 % des deutschen Marktvolumens repräsentieren. Bezugsgröße ist ein Quadratmeter Sichtmauerwerk (Maße des Steins 240 x 115 x 71 mm, Rohdichte 1.700 kg/m³, ohne Mörtel).
Vormauerziegel und Klinker bestehen im Wesentlichen aus Ton und Lehm (ca. 92 %) sowie Sand (ca. 8 %). Farbvarianten entstehen durch unterschiedliche natürliche Eisenoxid-Gehalte; gegebenenfalls werden geringe Mengen Eisen- oder Manganoxid zur Farbsteuerung zugesetzt. Das Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe nach REACH noch Biozidprodukte.
Die Herstellung umfasst den Abbau der Rohstoffe im Tagebau, deren Aufbereitung und Homogenisierung, die Formgebung per Strangpressverfahren, eine schonende Trocknung bei 60–120 °C sowie das Brennen in Tunnel- oder Herdwagenöfen bei 1.000–1.200 °C. Hauptenergieträger ist Erdgas. Durch den Brand erhalten die Steine ihre hohe Beständigkeit und Dauerhaftigkeit. Abwärme wird genutzt, Produktionsausschuss zurückgeführt, und die Werke betreiben Energiemanagementsysteme nach ISO 50001.
Während der Nutzung verändern sich die Ziegel nicht stofflich, sie sind emissionsarm und gesundheitlich unbedenklich. Beim Schneiden oder Bohren kann quarzhaltiger Staub freigesetzt werden, weshalb entsprechende Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Die Produkte sind nicht brennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102/EN 13501-2), geben im Brandfall keine toxischen Gase ab und sind beständig gegen Witterungseinflüsse. Die Referenznutzungsdauer beträgt 150 Jahre.
In der Rückbau- und Entsorgungsphase können rund 94 % der Ziegel recycelt und als Magerungsmittel, Zuschlagstoff im Beton, Füll- und Schüttmaterial im Tiefbau oder als Tennissand wiederverwertet werden; nur ca. 6 % werden deponiert (Deponieklasse I). Die Entsorgung erfolgt ohne besondere Umweltbelastung, da die Produkte chemisch inert und immobil sind.
Die Ergebnisse der Lebenszyklusanalyse zeigen, dass die Umweltwirkungen stark vom Energieeinsatz im Brennprozess geprägt sind. Für einen Quadratmeter Vormauerziegel/Klinker betragen die Treibhausgasemissionen im Herstellungsprozess (A1–A3) rund 27,7 kg CO₂-Äquivalente. Der Transport zur Baustelle (A4) verursacht etwa 1,5 kg CO₂-Äquivalente, die Verpackungsentsorgung (A5) rund 0,4 kg. Im Entsorgungsstadium entstehen weitere 0,1–0,4 kg CO₂-Äquivalente, während durch Recycling und Substitutionseffekte Gutschriften von bis zu 0,5 kg CO₂-Äquivalenten (Modul D) erzielt werden. Der Verbrauch nicht erneuerbarer Primärenergie liegt im Herstellungsprozess bei rund 433 MJ pro Quadratmeter, erneuerbare Primärenergie trägt mit etwa 36 MJ bei.
Die Gesamtbewertung macht deutlich, dass Vormauerziegel und Klinker durch ihre lange Lebensdauer, hohe Widerstandsfähigkeit und Recyclingfähigkeit ein ökologisch robustes und dauerhaftes Bauprodukt darstellen. Die größten ökologischen Hebel liegen in der Optimierung der Brenntechnik und im verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien.
Titelfoto: Gerd Schaller
